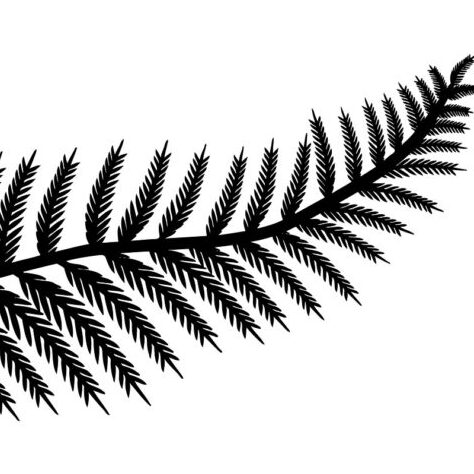Aus matschigem Boden ragen abgesägte Stümpfe, in den Wipfeln zwitschert es: Willkommen im Meggerwald – einem Chaos mit System, einem Dickicht der Bedürfnisse. Über 200 Eignerïnnen verfolgen hier jeweils eigene Interessen. Aber genau darin könnten sich Chancen verbergen. Eine Reportage aus dem Osten der Schweiz.

Der Meggerwald ist kein Märchenwald. Er ist Streitort, Experimentierfeld, Lebensraum und Naturexil für Städterïnnen. Hier zeigt sich exemplarisch, wie schwierig Waldpflege im 21. Jahrhundert geworden ist – zwischen Artensterben, Klimakrise, Rohstoffhunger und Menschen, die ihren Wald lieben, aber oft nicht mehr verstehen.
In diesem Wald wirkt Lukas Gerig. Sein Team hegt einen Wald, der das »Schmuckkästchen der Schweiz« säumt, die reichste Gemeinde hierzulande: Meggen im Kanton Luzern. Gerig ist hier Betriebsförster und setzt damit diverse Interessen von Waldeigentümern um. Einige sind emotional mit dem Erbe ihres Waldstücks stark verbunden, andere hingegen wissen nicht einmal, wo es sich befindet.

Manche Waldflächen gehören Erbgemeinschaften, andere einer Landwirtin, einer Kirchen- oder politischen Gemeinde. Die Eigentümerinnen kann man kaum kategorisieren. Sie sind Abbilder der Gesellschaft. Die Vorstellungen, wie ihr Waldstück auszusehen hat, gehen auseinander. So setzen manche darauf, Rohstoffe zu gewinnen, während andere ihre Parzelle in eine biodiverse Brache verwandeln – oder gar nichts tun. Das ist Waldpolitik im Kleinformat: viele Interessen, wenig Konsens.
Er will morsche Asthaufen statt Blümchenwiesen
»Das ist der schönste Wald der Schweiz!«, ruft ein Jogger dem Förster zu. Mit seiner Nähe zur Stadt Luzern lockt der Meggerwald als Erholungsort. Auch zum Grillen geht man mit der Familie in den Erlebnisraum Wald. »Aber das Verständnis, was dort eigentlich passiert, geht verloren«, sagt Gerig. Der Förster beobachtet, wie sich die Gesellschaft zunehmend von der Natur distanziert, entfremdet. Wie ein Wald zu sein hat, schwanke bei immer mehr Menschen zwischen einer Parkanlage und unberührter Wildnis. Dabei ist gerade das, was zwischen diesen Extremen passiert, das Spannende.

Lukas Gerig betritt einen Trampelpfad, der sich um Baumstümpfe und faulende Asthaufen windet. Kaum ein Kind würde hier Verstecken spielen – zu dunkel, zu unordentlich. Vor einigen Jahrzehnten »war der Wald immer super aufgeräumt«, sagt der Förster, weil man das Totholz verfeuerte. Heute sei das anders, und Förster müssen erklären, warum. Es braucht »Chaos« für neuen Lebensraum, in dem es zirpt und surrt. Weil der Mensch die Natur überall zurückdrängt, soll wenigstens der Wald artenreiche Räume in einem intakten Ökosystem bieten.
Zu einem gesunden Wald gehören Holzschläge
Dennoch könne es sinnvoll sein, dem Wald Holz zu entnehmen. Wenn Gerigs Team Bäume fällt, mache es das nicht aus Profitgier. Hievt er ältere Bäume aus dem Wald, schafft das offene Flächen – und damit Licht und Luft für junge Bäume. Flackert das Sonnenlicht durch die Blätter, bietet das die Chance zu keimen, verdunkelnde Brombeersträucher zu überwinden und gen Sonne zu ranken.

Im Meggerwald beschleunigen Förster mit Holzschlägen diese natürliche Sukzession. Denn »was der Mensch nicht aus dem Wald holt, erledigt die Natur von selbst«, etwa nach einem Sturm, sagt Gerig. Er sieht im Wald »ein riesengroßes Potenzial, Synergien für eine Kreislaufwirtschaft zu nutzen.« Den Wald als Baumarkt zu begreifen, funktioniere allerdings nicht, sagt Gerig. Er unterstützt natürliche Abläufe, stößt an oder bremst. Der Förster sagt: »Generell entwerfe ich keinen Bauplan vom Wald, sondern greife ein und lenke.« Jeder Hektar braucht seine eigene Therapie, die er begleiten, aber nicht dominieren kann.
Einige Meter weiter merkt selbst das ungeübte Auge, wie fragmentiert der Wald ist: Baumstümpfe neben jungen Bäumen zeigen, dass diese Parzelle jemand anderes verantwortet als die, in der es im Waldweiher plätschert und das Unterholz wuchert. Mancherorts stecken Ästhetik und Erholung zurück, weil Eigentümerinnen nachwachsenden Baustoff gewinnen wollen. Betriebsförster Gerig berät sie und stellt sicher, das Holz zu schlagen, abzutransportieren und zu verkaufen. Dabei muss er alles mit der jeweiligen Waldeigentümerin absprechen, denn er darf keine Maßnahme eigenhändig durchführen oder anordnen.

Nur fehlt es an Händen, die diesen Wandel antreiben. Insgesamt ist die Wirtschaftlichkeit des Waldes bedroht. Fachkräfte fehlen, und die wenigen, die es noch gibt, beklagen miese Löhne. Arbeit im Wald lohnt nicht mehr.
»Wir sollten uns fragen: Was ist es unserer Gesellschaft wert, Flächen offenzuhalten?«

Das Label »Schweizer Holz« hilft – für den Geldbeutel, aber auch, damit Waldarbeitende nicht in einen Topf geworfen werden mit der Rodungsindustrie im Regenwald: »Wir haben in der Schweiz ein extrem restriktives Waldgesetz und dürfen gar kein Raubbau an der Natur betreiben«, sagt Gerig. Er kämpft gegen die weit verbreitete Haltung, dass Holznutzung die Umwelt zerstöre.
Dennoch verhält es sich heute oft so: Wo die Motorsäge lärmt, beginnt eine Debatte – und nicht selten ein Missverständnis. Er werde oft von Passanten »als Umweltzerstörer beschimpft«. Eigentlich müsse in der Schweiz noch mehr Holz geschlagen werden, da der landesweite Waldbestand überaltert. Allerdings herrscht im Schweizer Wald keine Bewirtschaftungspflicht. Mancherorts »setzt deswegen niemand den Wald in Wert«, sagt der Förster. Anderswo gibt es den Rohstoff günstiger. Dort bewegt sich die Holzwirtschaft auf ein »race to the bottom« zu, bei dem mehr Bäume abgeholzt werden, als neue nachwachsen können.
Die Klimakrise im Wurzelwerk
Dabei sind gesunde und robuste Wälder wichtiger denn je: In Zukunft werden sich die stabilen Großwetterlagen häufen. Das hört sich harmlos an, bedeutet aber: Es regnet wochen- und monatelang gar nicht oder extrem intensiv. Auch an diesem Tag fällt kein Regentropfen auf den Waldboden.

Schon heute versucht Gerig den Meggerwald, der zu drei Vierteln aus Nadelholz besteht, »klimafit« zu machen. Doch wer den Wald auf Zukunft trimmen will, muss erst mit der Vergangenheit aufräumen. Im langfristigen Ökosystem Wald sind die Spuren seiner Vorgänger sichtbar. Einst pflanzten sie Fichten als profitables Gehölz. Sie werden vom Wild vergrämt und wachsen rasch. Heute sind sie verletzbar geworden. Als Flachwurzler sind sie, wie Försterinnen sagen, »windwurfgefährdet«. Und sobald die obersten Bodenschichten austrocknen, fehlt ihnen Wasser. Der Borkenkäfer stürzt sich auf die vom Durst geschwächten Bäume.
»Monokulturen sind ein viel zu hohes Risiko. Deswegen sage ich: Immer möglichst divers fahren und das Risiko streuen.«

Steigen die Temperaturen, erhöht sich für den Förster auch der Druck zu handeln. »Immerhin wissen wir heute viel mehr als frühere Generationen«, sagt er. »Die Natur in ihrer Gesamtheit zu überschauen und zu verstehen« könne er nicht. Umso wichtiger sind Experimente: Neues ausprobieren, Fehler machen, zusehen, lernen, wie Gerig sagt.
Grundsätzlich wollen Schweizer Förster zurück zu »naturnahen Mischwäldern«. Nach und nach ersetzt Gerig Fichten und andere (Halb-)Schattenbaumarten durch Eichen und Artgenossen, die Wärme und Licht lieben.
Vor allem setzt sein Team darauf, die einheimischen Baumarten natürlich zu verjüngen. Denn sind diese noch frisch und vital, passen sie sich erstens besser an den Klimawandel an. Und zweitens können sie in ihrer Wachstumsphase deutlich mehr Treibhausgase speichern als alte Bäume. Noch binden Schweizer Wälder mehr CO2 als sie freisetzen. Anders als deutsche Wälder, die sich landesweit von der CO2-Senke zur CO2-Quelle gewandelt haben. Setze sein Team aber die Säge an, gebe es schnell einen gesellschaftlichen Konflikt, weil sie »alte wunderschöne Buchen« fällten, sagt Gerig.

Wasser gibt’s genug
Die gute Nachricht: Der Meggerwald verdurstet nicht so schnell wie Wälder auf trockenem Kalkboden, etwa im Jura, in Süddeutschland oder Österreich. Auf rund fünf Quadratkilometern wächst er auf den Moränen eines einstigen Gletschers. Das bedeutet, dass »besondere Waldgesellschaften« auf den sauren, trockenen Kuppen und nassen Senken der gewellten Landschaft wachsen, wie etwa Moorbirken oder Sumpf-Blutaugen.
Um noch mehr verschiedene Tiere und Pflanzen in den Wald zu bringen, hebt Gerig einige dieser Senken bis auf die Lehmschichten aus und streicht die Grube mit Lehm aus – fertig ist ein Waldweiher. Innerhalb von ein bis zwei Jahren ziehen seltene Arten wie die Gelbbauchunke und Ringelnatter ein. Wo Wasser ist, brummt das Leben. Und das sei letztlich für alle Eignerinnen gut: Ein intaktes Ökosystem ist der Grundpfeiler dafür, unterschiedliche Bedürfnisse im Wald zu stillen.

In der Klimakrise gleicht die Arbeit der von Sisyphos
Doch ein solches intaktes Ökosystem zu schaffen oder zumindest zu fördern, ist nicht immer leicht. Gerig stoppt vor einem anderthalb Hektar großen Gebiet, das 2018 erst Sturmtief Burglind, ein Jahr später ein starkes Gewitter, danach der Borkenkäfer und 2020 ein weiteres Unwetter verheerte. Auf der Lichtung ragen zersplitterte Stämme empor, neben ihnen wachsen umzäunte Jungbäume. Gerig sagt: »Die ersten zwei Jahre nach 2020 hat mir das Gebiet hier keine Freude bereitet.« All die Tiefschläge in »seinem« Wald setzten dem Förster zu.
Doch dann begann er, diverse Baumarten anzupflanzen und die Flora zu verjüngen. Mit Blick auf die umzäunten Jungbäume sagt er: »Wenn ich das heute sehe, ist das eine Riesenfreude.« Heute wachsen dort Pionierinnen wie die Birke oder die Vogelbeere und klimataugliche Baumarten wie Eiche, Kirsche, Kastanie, Föhre. Sie florieren neben altbekannten Tannen, Buchen und ja – auch Fichten.
Gerig fährt einen pragmatischen Ansatz. Für ihn scheint es sinnlos, den Waldbestand nur eindimensional, also auf eine Waldfunktion ausgerichtet, zu bewirtschaften. Deswegen lehnt er es ab, Waldbestände nur durch Wasserflächen für einige Tierarten zu ersetzen:

»Manche konzentrieren sich auf Tagfalter und Schmetterlinge, andere auf Gräser oder Kastanien. Diesen Tunnelblick muss man öffnen.«
Die Arbeit des Försters, die vielen kleinen Waldparzellen zu pflegen, gleicht einer Herkulesaufgabe. Das Mosaik unterschiedlichster Waldstrukturen führt aber dazu, dass viele Waldfunktionen automatisch existieren. Weil es 200 Eigentümer gibt, arbeitet Gerig mit »200 verschiedenen Ausgangslagen, positiv wie negativ«.
Seine Aufgabe beschreibt er damit, »alles ins grosse Ganze einzuordnen, um dann einen Weg einzuschlagen.« Der Spielraum ist jedoch begrenzt. Weder könne er etwas am Niederschlag verändern noch am Boden oder in der Luft. Und wie sich seine Strategien auswirken, zeigt sich erst in fünfzig Jahren. Seine Arbeit passiere oft nach dem Motto »einfach schauen, ob es funktioniert«. Dabei stösst der Mensch in der Klimakrise Prozesse an, die für die langsam wachsenden Bäume zu schnell ablaufen könnten: »In absehbarer Zeit werden wir vor grossen Herausforderungen stehen«, sagt Gerig.
Wenn der alte Baum wegkommt, muss der junge schon wachsen
Seine Arbeit mit dem Licht erfordert ein sensibles Timing: »Wenn der alte Baum wegkommt, muss ein junger schon wachsen. Diese Schnittpunkte müssen wir erreichen.« Hundertfach.
Nur braucht es im Mosaik des Meggerwaldes vor allem eines: Geduld. Und Mut, »in unserer kurzlebigen Zeit Jahre zu warten, um zu schauen, wie sich etwas entwickelt«. Förster widerstehen dem Druck, schnelle Ergebnisse zu produzieren. Sie denken weniger in Quartalszahlen, als in Jahresringen und wissen: Viele Generationen zuvor schauten in und durch Wälder. Zusammen mit anderen Lebewesen machen sie Wälder zu dem, was sie heute sind. Und das lässt sich verändern, langsam.

Als Förster weiß Gerig auch: Stirbt der Meggerwald, wäre das ein Problem für die Menschen. Sie sind es, die saubere Luft und gereinigtes Grundwasser brauchen und von der Artenvielfalt, der Naherholung, dem Schutz vor Steinschlägen und dem Bauholz zehren. Jeder will etwas anderes vom Wald. Er selbst ist aber nicht auf die Menschheit angewiesen. Der Wald kann Vieles sein, wenn der Mensch innehält, aufblickt und lernt, zuzuhören.