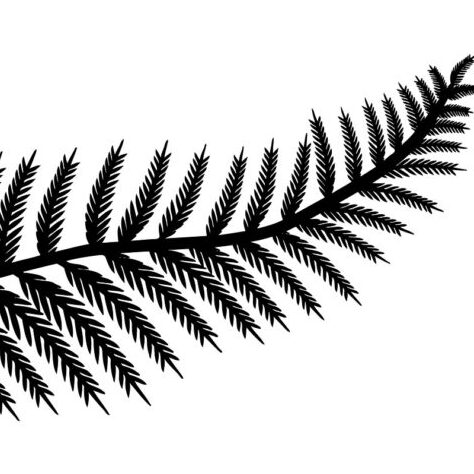Früher begruben die Schlammmassen des Rollibocks ganze Dörfer unter sich. Die Mär des zotteligen Gletscherwesens suchte die Menschen im Tal heim. Heute schauen sie immer noch ängstlich nach oben, fürchten jedoch, dass der Rollibock seine ganze Kraft verliert. Wie es ist, auf dem sterbenden Aletschgletscher zu wandern.
Auf 2200 Metern keuchen fünfzehn Schülerinnen und Schüler in dünner Luft nach oben. Der dichte Morgendunst verschluckt das Panorama. Zur Rechten verfallen Alpenhütten. In einem Stollen durchqueren sie den Tälligrat, ein Ausläufer des Eggishorns. Die Gruppe schlängelt sich unter flackerndem Licht an Pfützen vorbei und tritt hinaus in klaren Sonnenschein.
Vor den Schülerinnen und Schülern liegt die Gletscherstube Märjelen. Fünfzehn Gehminuten unterhalb der Hütte schiebt sich der Aletschgletscher gen Tal. Wegen steigender Temperaturen büsst er jährlich 30 bis 50 Meter an Länge ein. Alle Alpengletscher zusammen verloren 2021 400 Millionen Tonnen Eis. Diese Eismenge würde ausreichen, um die gesamte Fläche der Schweiz mit einer ein Zentimeter dicken Eisschicht zu bedecken.
Noch ist der Aletschgletscher in etwa so lang wie die Strecke zwischen Winterthur und Zürich. Doch das Eis schwindet, während immer weniger Schnee fällt – «ein Missverhältnis», sagt Marcel Albrecht.
Die Alpengletscher schmelzen

Der erfahrene Walliser Bergführer führt die Gruppe mitten hinein ins Zehrgebiet, wo Schnee und Eis abschmelzen. Allerorts tropft und rauscht es. Hier bricht sich das Schmelzwasser in kleinsten Löchern und tiefen Spalten Bahn. «Leider Gottes», sagt er, «hat sich die Gleichgewichtslinie total verschoben. Sie liegt heute bei 3500 Metern». Wo sie früher lag, ist schwer zu beziffern.
Früher habe das Nährgebiet ein Drittel des Aletsch ausgemacht, ist seit letztem Jahr jedoch auf ein Fünftel geschrumpft. Auch der viele Schnee im vergangenen Winter ändert daran nur sehr wenig, verwandelt sich doch ein Meter Neuschnee über zehn Jahre nur in einen Zentimeter Eis. Nicht umsonst denken Glaziologen in Jahrhundertschritten.
Der Bergführer wohnt hier oben in Fiesch, führt das Jungfrau-Hotel und dreht jeden Abend seine Runden mit den ehemaligen Schlittenhunden, zwei Huskys. «Bitte keine Fragen zur Klimakrise, die machen mürbe», bittet er lächelnd, doch auch er kann das Thema nicht umschiffen: «Es ist schon traurig. Wenn du da auf dem Gletscher stehst, und er ist an manchen Stellen so viel tiefer als kurz zuvor.» Die Messstationen der ETH Zürich ragen meterhoch aus dem Eis, dabei wurden sie erst im vergangenen September ins Eis gebohrt. «Das ist schon erschreckend», sagt er.

Das Gletscherherz, erklärt der Bergführer, liegt unter dem Concordia-Platz; ein riesiges Eisreservoir, das etwa 900 Meter tief ist. «Seit fünf Jahren beginnt der Platz massiv einzustürzen, weil das Eis von dort schneller wegfliesst», sagt Albrecht. Dabei habe der Aletschgletscher noch Glück, fehlten doch seinen Nachbarn, dem Fieschergletscher oder dem Steingletscher derartige Schnee- und Eisspeicher. Mit resignierter Stimme fragt er: «Diese Gletscher ziehen sich massiv zurück. Wenn du keine Zone hast, wo aus Schnee Eis wird, wie soll da ein Gletscher noch wachsen?»
Der Rollibock-Schrecken verängstigte die Menschen
Vor der Aletschhütte schlüpfen alle in die Klettergurte und machen sich auf den Weg zu den Seitenmoränen des Gletschers. Von Steinmännchen flankiert erzählt Albrecht, dass ihm das Schmelzen sogar helfe: «Ich habe viel Arbeit, muss aber weiter laufen.» Für ihn sorge «das Klimathema» für «einen grossen Run»: Immer mehr Menschen wollten bezeugen, wie schnell das «ewige» Eis verschwinde. Forschende nennen das den «Last-Chance-Effekt», wenn man die Folgen der Klimakrise anfassen kann.
Diese Sehnsucht steht im starken Kontrast zum 15. Jahrhundert. Die Menschen im Tal sahen damals in den Gletschern «immer etwas Schlechtes», sagt Albrecht: «Von dort drohte nur Gefahr, da geht man nicht hin.»
Der Grund: Des Öfteren durchbrach das Wasser des Märjelensees am Gletscherrand seine Eismauer und ergoss sich in Stein-Wasser-Schlammlawinen ins Rhonetal, zerstörte Dörfer: «Die Leute haben das als katastrophales Untier wahrgenommen, gross und zottelig, mit Steinen und Eis in den Haaren.» Der Mythos des Rollibocks war geboren.

In ihrer Not wandten sich die Fiescher an Gott: Ab dem 17. Jahrhundert beteten sie in alljährlichen Prozessionen, die umliegenden Gletscher mögen nicht weiter wachsen: «Beten können wir Walliser sehr gut», sagt Albrecht und meint ironisch: «Deswegen haben wir es heute geschafft: Der Rollibock ist vertrieben und der Gletscher verschwindet.»
Der Walliser erzählt, dass erst die koloniale Elite aus England die Menschen im Tal umdenken liess. Pensionierte Offiziere, Lehrerinnen und Pfarrer trieb es in die Alpen, und die bis dato gletscherscheuen Walliser hörten das Geldsäckli klingeln. Wirtschaftlich habe sich im Kanton bis heute wenig geändert: «Das Wallis lebt vom Tourismus», sagt Albrecht.
Und dann geht’s auf den Gletscher

Der Gletscherrücken wölbt sich graubraun aus dem Fels. Die Gruppe stülpt sich die Steigeisen über die Wanderschuhe, kratzt erst über den Stein und erklimmt dann den Gletscher. Dasselbe Seil gleitet verbindend durch die Karabiner. Bei jedem Schritt knirscht das «morsche» Eis – gut für einen sicheren Tritt, erklärt Albrecht. Vor jeder Gletscherspalte muss die Seilschaft sichergehen: Hat die Vorderfrau stabilen Halt oder ziehe ich sie oder den Hintermann mit einem unüberlegten Sprung in die türkise Tiefe?
Einige wenige schürfen sich die Hand an den Eiskanten auf. Kalter Gletscherwind pfeift um die Ohren. An einem kleinen Wasserbecken stoppt die Gruppe. Hier tanzen die einzigen ganzjährigen Bewohner: Gletscherflöhe. Die Schülerinnen und Schüler rasten auf einer Moräne, als der Erdkundelehrer Martin Edelmann ansetzt: «Wir sagen danke, lieber Gletscher, dass du aufräumst. Fehlten er und die Niederschläge als Förderbahn ins Tal, dann würden die Alpen im Schutt ertrinken.»

Albrecht fordert alle auf, die Hand auf Steine zu legen. Sind sie gross, können sie das darunterliegende Eis schützen. Kleinere jedoch nehmen die Sonnenenergie auf und geben sie als Wärme wieder ab. Aufgeheizt fressen sie sich ins matschige Eis. Um die dunklen Moränen schmilzt es deswegen rasant ab. Das Eis mit Saharastaub und kleinem Geröll obenauf sehe aus wie «Tiramisu», sagt ein Schüler.

Bergführer sind «eine mürrische Gesellschaft», sagt Albrecht. Und fährt fort: «Die dümmste Frage, die Touristen stellen», sei die nach dem Handeln. Nichts und niemand könne das Gletschersterben aufhalten. Viel früher hätte man reagieren müssen: «Seit dem Wirtschaftswachstum nach dem 2. Weltkrieg haben wir die Penaltys eigentlich alle verschossen.»
Und warum nicht die Felsen an den Gletscherrändern weiss anmalen und die Eismassen mit einer Plane zudecken, wie man es etwa am Rhonegletscher bereits vormacht? «Wenn das funktioniert, bin ich nicht mehr Bergführer, sondern verkaufe Folie», antwortet Albrecht. Mit dem Erdkundelehrer ist er sich einig, dass Folie und Farbe zwar punktuell schützen könnten, jedoch letztlich weder skalierbar noch ökologisch einwandfrei wären.
«Hier spürt man das Sublime, die Kraft der Natur»

Zum siebten Mal in seinem Lehrerdasein erkundet Edelmann mit einer Schulklasse den Gletscher. Er steht in einem Eiskessel, hohe Wände ragen empor, Wasser stürzt hinunter. «Das ist spektakulär hier, ein Abenteuer», sagt er: «Obwohl der Gletscher schmilzt, sehen wir doch das Sublime. Die Natur ist so gewaltig, und wenn du die Gletscherspalten überwindest und die ganze Kraft des Gletschers spürst, die er immer noch hat, dann fühlst du dich so klein.»
Der Aletschgletscher zeige dem Menschen seine Grenzen auf, der sich stets fragen müsse: «Was soll ich eigentlich in diesem Grenzraum?» Edelmann liebt sein Fach. Für ihn ist klar: Man kann die Eismassen nicht im Klassenzimmer simulieren.
Er sagt: «Du willst die Endorphine, das Haptische, das fühlbare Erlebnis, damit etwas haften bleibt. Dieses Aufregende ist das, worauf mich Jahre später Schüler ansprechen.» Hier oben spürt man die schwindende Kraft des Rollibocks.
Erst mit den Füssen auf dem Eis merke man, dass ein Gletscher eben nicht so cremig daherkomme, sondern voller scharfkantigem Schutt und Firn sei. Von dieser eindrücklichen Nähe aus könne man zukünftig das Spagat wagen: zwischen Wissen und Handeln. Bergführer Albrecht stimmt zu: «Das, was wir machen, ist kein Katastrophentourismus.» Vielmehr vermittle er jungen Menschen etwas Schönes, regt zum Nachdenken an.
Bei den Schülerinnen und Schülern fruchtet das. Da ist einerseits der Schrecken, wie schnell die Eisreserven schwinden: «Innerhalb eines Monats ein Meter weg, in Echtzeit», sagt einer. Auch seine Mitschülerin sagt: «Hier oben liegt fast kein Schnee. Auch der Fieschergletscher ist total im Eimer.»

Und doch berichten sie von einem «Jahrhunderterlebnis», auf dem Gletscher zu laufen und dem Privileg, einem «ganz eigenen Ökosystem» nachzuspüren. Ein Schüler betont, wie ermutigend es sei, einen robusten Gletscher wie den Aletsch zu sehen, mit einem noch recht stabilen Nährgebiet. Eine Schülerin empfiehlt, die Gletscherränder am Fels rot zu markieren, um den Wandel noch fassbarer zu machen.
Zurück in der Unterkunft erzählen die Zehntklässler von ihren Berufszielen: Uno-Mitarbeiter, Nachhaltigkeitsmanager, Astroteilchenphysikerin – sie verschliessen sich nicht vor den Krisen.
In den Schweizer Alpen steht eine neue Welt vor der Tür

Zu ihren Lebzeiten wird sich vieles in den Alpenhöhen verändern. Unter den aktuellen klimatischen Vorzeichen verwandelt sich der Concordia-Platz «in ein ganz grosses Wasserloch», sagt Albrecht. An der Jungfrau wird dann noch ein kleines Eisschild kleben bleiben.
Für uns Menschen sei dies problematisch, die Natur werde sich jedoch anpassen und «nimmt sich alles wieder zurück». Die Alpflächen verwalden. Büsche und Bäume schlagen nach Hangrutschen rasch Wurzeln. Während früher die Waldgrenze bei 1800 Metern lag, erfreut sich an den Südhängen bis hoch auf 2300 Meter nun ein Mischwald am Klimawandel.
Längst verblassen die Schrecken des Rollibocks. Andere, verstörende Monster nehmen seinen Platz ein. Heute wünscht man sich im Wallis und darüber hinaus, dass sich die vielen kalten Arme des Ungetüms schützend über den schmelzenden Gletscher legen und sein Verschwinden aufhalten.