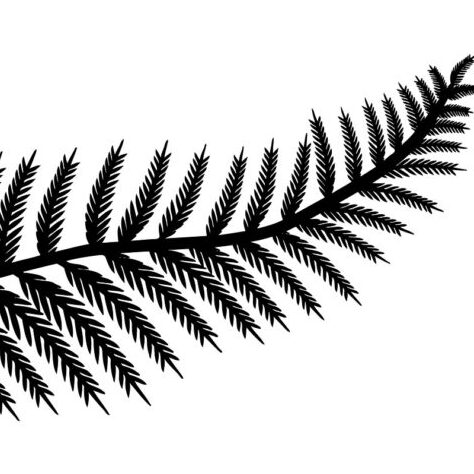Der Christbaum ist Massenware. Gerade gewachsen und buschig soll er sein. Immer mehr Menschen wünschen sich zudem einen Baum, der in ihrer Region gewachsen ist. Gibt es den Christbaum, der die Umwelt schont?
Im Hof auf der Rietwies riecht es nach Heu. Die Kühe mampfen, und aus ihren Nüstern wirbeln Atemwölkchen in die kalte Luft. Die Kaubewegungen lassen die Glocken um ihre Hälse erklingen. Über Nacht hat sich Raureif auf das Gras gelegt.
Würden die Kühe ihren Blick vom Futtertrog lösen, so sähen sie auf die zwei Hektar grosse Christbaumplantage der Familie Steiner-Kaufmann. Dort wachsen die in der Schweiz fremden Nordmanntannen und Blaufichten, aber auch einheimische Rottannen. In Reih und Glied stehen sie geordnet, unterschiedlich gross gewachsen.
Kann eine solche Anlage die Umwelt schonen, oder ist eine «nachhaltige Plantage» ein Widerspruch in sich? Die St.Galler Mitte-Präsidentin Franziska Steiner-Kaufmann tritt auf den Hof, schwingt die Motorsäge auf die Schulter und erklärt ihren Ansatz.
Die Tannenbaumkultur ist ein langfristiges Familienprojekt

Während sie die Anlage erklimmt, erzählt sie von ihrer Familientradition: Seit 1988 hegen und pflegen ihre Eltern Christbäume. Sie sagt:
«Ich bin in den Nadeln aufgewachsen»
Seit Steiner-Kaufmann und ihr Mann in den Betrieb eingestiegen sind, versuchen sie, die Plantage stetig zu vergrössern. Eine langfristige Planung, investieren sie doch in jeden Baum acht Jahre Arbeit.
«In Schweizer Stuben stehen 1,5 Millionen Christbäume», sagt Steiner-Kaufmann. Die Hälfte davon stamme mittlerweile aus der Schweiz, Tendenz steigend. Gerade in Pandemiezeiten habe ihr Laden gebrummt, weil viele Menschen zu Hause geblieben seien und getrennt gefeiert hätten.
Die Mitte-Präsidentin führt durchs Plantagendickicht
Wir streifen die Blaufichten. Zur Linken ragen mickrige Tannenzweige nur wenige Zentimeter aus dem Boden: «In den ersten Jahren wirken sie schwach», sagt Steiner-Kaufmann. «Sie geben ihre ganze Kraft in die Wurzeln.» Sind sie einmal einen Meter gross, wachsen die Bäume jährlich bis zu 30 Zentimeter.
An einigen Exemplaren hat Steiner-Kaufmann rote Fähnchen gehisst. Sie sind reserviert. Ungebrochen sei der Strom der Leute, die aus der Christbaumsuche traditionell ein Familien-Event machen. In Gommiswald schauen die Kinder bei den Kühen vorbei, die Eltern trinken einen Glühwein, und dann geht’s in die Anlage, um den schönsten Baum zu sägen.
Von Mäusen, Läusen und anderen Bedrohungen
Wir stolpern über einen verendeten Trieb mit roten Nadeln. Steiner-Kaufmann verliert 10 bis 20 Prozent ihrer Bäume. Das grösste Kopfzerbrechen bereiten ihr die Mäuse, die an den Christbaumwurzeln knabbern.
Durch die Klimakrise mit ihren milden Wintern steige zudem die Gefahr eines Lausbefalls: «Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Setzt dann noch ein später Aprilfrost oder starker Hagel ein, sterben die jungen Triebe ab und die ‹optische Qualität› der Bäume leide», sagt Steiner-Kaufmann.
Eine CD dreht sich im Wind. Sie soll Rehe und Raubvögel irritieren. Letztere wollen sich in den Baumkronen einen guten Aussichtspunkt schaffen. Ihre Mäusejagd wäre zwar hilfreich, ist jedoch auch ein Problem: Oft bricht der Hauptstamm unter dem Gewicht der Vögel zusammen. Steiner-Kaufmann bietet ihnen mit hohen Bambusstöcken Alternativen.
Zwischen den Bäumen kreucht und fleucht es

Um die Früchte im Dezember ernten zu können, ist jedoch schweisstreibende Arbeit nötig. Zwischen Frühling und August mäht die Familie sieben Stunden pro Woche die Lücken zwischen den Bäumen. Auf Herbizide verzichtet Steiner-Kaufmann.
Da ihre Familie die Plantage schonend bewirtschaftet, beobachtet sie bei ihren Streifzügen eine bunte Artenvielfalt: Hasen, Singvögel und Blindschleichen. Steiner-Kaufmann sagt: «Die Tiere haben höheres und tieferes Gras, um sich zu verstecken. In diesem halboffenen Ökosystem können sie laufen, wohin sie wollen.»
Zudem haben die jungen Bäume eine überraschende Klimabilanz: «Ein Hektar Christbäume bindet in seinen acht Jahren Wachstum so viel CO2, wie wenn ein Mensch 580-mal nach London und zurück fliegt», sagt Steiner-Kaufmann.

Können regionale Christbäume also Retter in der Klimanot sein? Für Forstingenieur Stefan Buob vom St.Galler Kantonsforstamt kommt es auf den Transportweg und die Grösse der bewirtschafteten Fläche an. In der Regel seien grössere Anlagen eingezäunt und die meist exotischen Pflanzen mit Dünger und Pestiziden behandelt: «Dann ist die Plantage für wild lebende Tiere nicht mehr nutzbar.»
Kleinere Anlagen wie die von Steiner-Kaufmann fügen sich besser in die Landschaft ein. Dennoch sei die Christbaumindustrie ein kleiner Wirtschaftszweig, bei dem der Produktionsfaktor im Vordergrund stehe, nicht die Artenvielfalt.
In Grossanlagen schadet die Bewirtschaftung der Umwelt
Steiner-Kaufmann verneint das nicht. Während sie die Motorsäge an einem Stamm ansetzt, räumt sie ein: «Es wäre nachhaltiger, die Bäume nicht zu schneiden.» Dennoch kenne sie keinen Ostschweizer Christbaumbetrieb, der seine Anlage intensiv bewirtschafte. In Gommiswald häckselt sie die krummen Bäume und kompostiert sie. Regionale Betriebe produzieren daraus Biogas oder nutzen Zweige und Nadeln als Futter für Pferde und Ziegen.
Ihr Vater schlendert vorbei und sagt: «In Deutschland ist das anders, da werden die alten Christbäume oft verbrannt.» Dort und in Dänemark wachsen die Nordmanntannen in grossen Farmen, werden gedüngt und maschinell gefällt. Seine Tochter bringt es auf den Punkt: «Wenn unreflektiert produziert wird, wird auch unreflektiert produziert.» Es schmerze sie, wenn sie die Bäume bereits Ende Oktober in enge Netze und auf Paletten eingepresst sieht. Sie ergänzt:
«Das sieht man den Bäumen an – das ist nicht mehr nachhaltig. Beim Konsum sollte man sich an Weihnachten als Fest der Nächstenliebe orientieren.»
Das Umweltbewusstsein werde aber durch den Black Friday und den Fokus auf die Bescherung untergraben. Immerhin: Grössere Unternehmen wie Coop oder die Landi nehmen laut Steiner-Kaufmann vermehrt Schweizer Bäume in ihr Sortiment auf.

Sie nimmt einen dünnen Stamm in die Hand und sagt: «Wir kerben den Christbaum immer wieder ein.» So will Steiner-Kaufmann den Baum dazu bringen, seinen Saft für ein dichtes Nadelkleid zu nutzen. Sie sagt: «Noch immer wollen viele den perfekten Baum.» Steiner-Kaufmann bezeichnet diesen Teil der Kundschaft als «ein bisschen verwöhnt». Sie plädiert dafür, alle Bäume wertzuschätzen – auch die krummen.