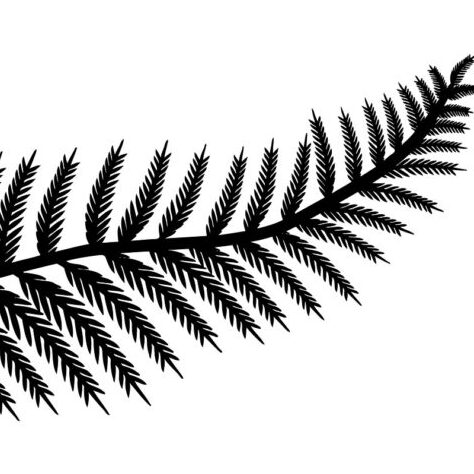Der Wattwurm gräbt das Watt um und haucht ihm so Leben ein. Jetzt machen die Veränderungen in seinem Lebensraum dem aber derart zu schaffen, dass er hier seine Geschichte erzählt. Der Wattarchitekt und seine Sicht auf Dünger, Deiche und die vielen anderen Bedrohungen für das Ökosystem.

Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein Wattwurm, arenicola marina, und teil mir einen Quadratmeter Schlick vor dem dänischen Esbjerg mit vierzig Artgenossïnnen. Die Jungen winden sich noch planlos durchs Watt und graben sinnlos Löcher. Ich hingegen? Ich belüfte und bau’ Kanäle, die halten. Ich bin – sorry, für das Pathos – das letzte Schlängeln unter euren blinden Gummistiefeln.
Ich bin kein junger Wurm mehr. Ich bin fünf Jahre alt, nur wenige unter uns leben länger. Ich grabe nicht mehr so tief wie früher, aber ich weiß, wann das Wasser kommt, bevor ihr Menschen die Flut überhaupt seht. Ich bin zwar müde, gehe aber nicht in den Ruhestand. Noch immer bin ich mit Leidenschaft Gärtner, Ingenieur und Architekt des Wattenmeers. Ich kenne jede Strömung und jede Sandrippe beim Vornamen.
Die Small Five des Wattenmeers
Zusammen mit der Herzmuschel, der Gemeinen Wattschnecke, der Gemeinen Strandkrabbe und der Nordseegarnele gehört der Wattwurm zu den „Small five“, den fünf wichtigsten wirbellosen Arten des Wattenmeeres. Sie erhalten das Watt und dienen als Nahrungsquellen für andere Tiere. Die Herzmuschel filtert das Wasser. Ohne die Wattschnecke würden sich abgestorbene Pflanzenreste viel langsamer zersetzen. Die Strandkrabbe passt sich gut an wandelnde Umweltbedingungen an. Die Garnele tarnt sich perfekt und ist wie die Krabbe eine geschickte Jägerin.
Ihr Menschen müsst euch tief bücken, um meinen Spuren zu folgen. Doch ihr kommt sowieso nicht meinetwegen und merkt, wie ich mich um eure Zehen winde. Weder verzücke ich mit den Knopfaugen einer Kegelrobbe noch kann ich es mit der Schönheit eines Glattrochens aufnehmen, der durch die Nordsee schwebt.
Ihr zählt 92 Milliarden Wattwürmer weltweit und denkt, wir wären nicht kaputtzukriegen. Ihr glaubt, wir könnten selbst dann überleben, wenn der Rhythmus zwischen Ebbe und Flut aus dem Takt gerät. Ihr täuscht euch. Ich spüre den Wandel und habe Angst. Mein Kummer sollte euch aufrütteln und dazu bewegen, unseren gemeinsamen Lebensraum zu bewahren: das Wattenmeer.
Leben in der Wohnröhre
Was der Regenwurm im Garten bedeutet, bedeuten wir Wattwürmer für das Gezeitenland. Indem ich permanent fresse und ausscheide, halte ich das Sediment gesund. Ich schlucke feine Partikel, lagere Sandkörner und Muschelschalen tief ab, lockere und schichte so den Boden.
Der Lebenszyklus des Wattwurms
Das Leben eines Wattwurms beginnt im offenen Wasser. Die Tiere laichen synchron während Springfluten um Voll- oder Neumond. Im Oktober geben die Männchen ihr Sperma ins Wasser ab. Sobald die Spermien die Wohnröhre eines Weibchens erreichen, reagiert das Weibchen und gibt Eizellen ab. Die Befruchtung erfolgt somit extern im Wasser. Anschließend nehmen die Weibchen die befruchteten Eier in ihre Wohnröhren auf, indem sie pumpen oder ihnen die Strömung hilft. Nach etwa zwei Wochen, in denen die Weibchen das Fressen einstellen, schlüpfen die nur wenige Millimeter großen Larven. In den ersten Lebenswochen treiben sie frei im Wasser und sind von einer schützenden Schleimhülle umgeben. Diese Phase ist besonders gefährlich, da viele Larven Fischen und Quallen zum Opfer fallen. Nach etwa vier bis sechs Wochen sinken die Larven zu Boden, beginnen zu graben und beziehen nach ein paar Fehlversuchen ihre erste Wohnröhre. Nach etwa zwei Jahren erreichen Wattwürmer ihre Geschlechtsreife. Die meisten Tiere werden fünf bis sechs Jahre alt.
Mit meinen Borsten grabe ich mich durch den Sand und lebe in U-förmigen Wohnröhren, die bis zu 40 Zentimeter tief reichen. Mit meinem Rüssel sauge ich einen Teelöffel Schlick pro Stunde ein. Hochgerechnet sind das 25 Kilogramm, die ich pro Jahr durch meinen Darm schleuse. Der trennt leckere Algen und Bakterien vom Sand. Ich liebe mein Eigenheim im Schlick: Es ist energiesparend, sturmsicher und im gesunden Watt immer bestens durchlüftet. Aber das ändert sich gerade.

Alle halbe Stunde robbe ich mich rückwärts an die Oberfläche. Dort scheide ich Sandhäufchen aus, die euch an Spaghettiknäuel erinnern. Mit meinen vierzig Nachbarïnnen wälze ich so die gesamte oberste Sedimentschicht einmal jährlich um. Wir durchlüften den Boden nicht nur, sondern bewässern ihn auch: Wenn ich fresse und den Sand durch mich pumpe, strömt Wasser durch meine Wohnröhre, das Sauerstoff in den Boden trägt. Was hinten rauskommt? Fruchtbarer Schlick für das »Arenicolazän« – das Zeitalter des Wattwurms. Ich arbeite leise, aber gründlich. Ihr würdet sagen: ein bodenständiger Typ mit einem Hang zur Tiefenpflege.
Meine Milliarden Wurmfreundïnnen und ich bilden also die Lunge des Watts. Nehmt euch einen Augenblick Zeit und schaut ganz genau hin: Nahe unserer Röhren ist der Schlick heller, weil er oxidiert ist. An meinen Röhrenwänden leben sogar Strudelwürmer und Flohkrebse, weil sie den Sauerstoff brauchen und außerdem Nahrung aus meinem Kot und Harn ziehen. Ich dünge den Boden von innen. Meine Sauerstoffinseln halten den Lebensraum offen.
Der Körper eines Wattwurms
Der Wattwurm hat kein Oben und Unten, sondern nur ein fingerdickes Vorderteil, in dem alle wichtigen Organe liegen, und ein dünnes Hinterende, durch das sich der Darm zieht. Im sauerstoffarmen Schlick, dessen Poren vollständig mit Wasser gefüllt sind, herrschen extreme Bedingungen. Aber genau daran ist die Art perfekt angepasst: Wattwürmer atmen über die Haut und über Kiemenbüschel in der Körpermitte. Ihr Blutfarbstoff zirkuliert frei in der Körperflüssigkeit und kann rund 50-mal mehr Sauerstoff binden als menschliches Hämoglobin.
Ich füttere Vögel, Fische und Krabben
Viele meiner Freundïnnen enden im Schnabel eines Watvogels. Zwergschnepfen und Rotschenkel patrouillieren im Watt und spähen nach frischen Haufen. Sie bohren ihre Schnäbel in unsere Röhren. Bei Gefahr können wir unser hinteres Ende abwerfen und in die Tiefe entrinnen. Einmal verkürzte mich ein Knutt.
Kommt die Flut, dann verziehen sich zwar die Vögel, aber dafür machen Schollen und Strandkrabben Jagd auf uns.
Ihr vergiftet den Schlick
Pflügt der Krabbenkutter mit dem Grundschleppnetz durch das Watt, verletzt oder tötet das Hunderte Wirbellose. Und bei Ebbe eilen Sportanglerïnnen in den Schlick und graben uns mit Spaten und Forken aus. Das muss man sich mal vorstellen: In den Niederlanden holen sie uns mit mechanischen »Erntemaschinen« aus dem Boden. Fast wie Gemüse.
Ich hab’ einen feinen Geschmack. Aber nicht alles, was glänzt, ist genießbar: Durch meinen Darm ziehe ich immer öfter bunte Teilchen, die ich nicht verdauen kann: Mikroplastik. Der Spülsaum des Watts ist voll davon. Durch das Plastik verliere ich meinen Appetit. Seine Weichmacher lösen Stress aus und schwächen mein Gewebe. Manchmal gleite ich durch regenbogenfarbenes Wasser. Das Öl eurer Schiffe und die Giftstoffe aus Schadstoffen stören meinen Lebensraum.
Ihr überdüngt die Böden. Deshalb sprießen die Fäden der Grünalgen und verweben sich zu einem dichten Teppich. Blühen die Algen in immer wärmerem Wasser, röcheln ganze Populationen von uns wegen der »grünen Plage« nach Luft. Sie verstopfen unsere Trichterwohnungen. Wenn die Algen dann verrotten, entziehen die freigesetzten Bakterien mir und dem gesamten Lebensraum den Sauerstoff.
Ihr bedroht mein Zuhause
Die Rippelfelder der Nordseeküste sind unser Zuhause. Wir gehören zu den seltenen Arten, die in diesem Gezeitenland überleben können. Man könnte sagen: Wir führen ein amphibisches Dasein.
Das Wattenmeer fängt Sedimente ein und lagert sie wieder ab. In der Klimakrise steigt der Meeresspiegel aber schneller als sich neues Sediment ablagern kann. Das Watt droht zu ertrinken. Wir Wattwürmer können uns an Sauerstoffarmut anpassen, aber nicht ständig. Irgendwann schnappen auch wir nach Luft. Unser Zuhause könnte verschwinden.
Ich kann mit Krabben umgehen, mit Schiffsöl und mit Anglerïnnen. Aber langfristig hilft gegen das, was ihr „Klimakrise“ nennt, kein Trick. Sie könnte das »Arenicolazän« abrupt beenden. Früher war das Watt ein sicherer Ort. Heute spüre ich, wie es immer wärmer und die Luft immer dünner wird.
Die Wärme, die ihr ins Meer treibt, fühlt sich für uns an wie Fieber. Das stresst mich. Bereits bei Temperaturen über 18 Grad leide ich. Eure Forscherinnen haben vor der deutschen Küste bereits ein Massensterben in unserem Milliardenheer beobachtet. Wer kann, wandert nach Norden. Aber für uns Würmer ist das keine Option. Wir sind zu sehr an unseren angestammten Lebensraum gebunden. Je wärmer das Wasser wird, desto weniger Sauerstoff bindet es und wird zum Algenparadies. An manchen Orten erhitzt sich das seichte Wasser so stark, dass wir und Herzmuscheln sterben.
Fremde Arten drängen in unseren Lebensraum. Noch ist nicht in jedem Fall klar, ob sie mir freundlich gesinnt sind oder nicht. Was ich aber mit schmerzlicher Sicherheit weiß: Die Riffe der eingeschleppten Pazifischen Auster haben mancherorts offene Wattflächen verdrängt. Dort haben meine Freundïnnen ihren Lebensraum verloren. Ähnlich Schockierendes berichten sie über die wichtigen Schlickgras-Flächen. Das Watt verändert sich. Ich sehe kaum noch Gemeine Wattschnecken oder Bäumchenröhrenwürmer, die früher mit uns den Schlick prägten. Immerhin haben sich einhundert eingeschleppte Arten im Watt angesiedelt, die uns Einheimischen den Platz nicht streitig machen.
Ihr verschanzt euch hinter Wellenbrechern
Ich verstehe euer Sehnen nach Stabilität. Ihr errichtet Deiche, um euer Hinterland vor dem Meer zu schützen. Damit verändert ihr aber die Gezeitendynamik. Früher breitete sich das Wasser bei Flut über die Küstenlinie aus. Heute engen Deiche das Wasser ein. Meine Röhre fällt für immer kürzere Zeit trocken. Diese Verschnaufpause brauche ich aber: Erst bei Ebbe sinkt der Wasserdruck auf das Sediment. Dadurch kann ich sauerstoffreicheres Wasser durch meine Wohnröhre pumpen.
Ihr überschätzt eure Mauern und das Leben auf vermeintlich festem Grund. Eine starre Küstenverteidigung funktioniert nicht. Schon einmal holte sich im Jahr 1362 die Nordsee eine Menschenstadt im entwässerten Watt zurück: Rungholt. Nehmt euch ein Beispiel an uns Wattwürmern! Dann lernt Ihr auch, mit dem Wasser zu leben – und nicht dagegen. Eure Küsten könnten mitwachsen, wenn Meerwasser in die Polder hinter den Deichen strömen und dort Sand ablagern dürfte. Auf der dänischen Insel Rømø habt Ihr immerhin schon Häuser auf Stelzen gebaut.
Ich brauche eure Hilfe!
Stattdessen setzt Ihr darauf, gezielt Sand aus der Nordsee aufzuspülen, um zu verhindern, das Meer eure Strände verschlingt. „Sedimentmanagement“ nennt Ihr das. Bald werdet Ihr verstehen, dass sich Küsten- und Umweltschutz nicht ausschließen. Schüttet doch lieber Sandspeicher auf und lernt, wohin die Gezeiten Sedimente tragen. Nur wenn das Watt mit dem Meer wächst, kann ich überleben. Und mit mir der ganze Lebensraum. Die Austernriffe sind zwar garstig, aber sie könnten dabei helfen. Sie wachsen so schnell wie der Meeresspiegel und dienen als natürliche Barrieren.
Auf dem Papier genießt mein Zuhause, das Wattenmeer, einen hohen Schutzstatus. Ihr nennt mich Leitart oder Schlüsselspezies. Das schmeichelt mir, aber ich kann die ganze Arbeit nicht allein machen. Es liegt an euch, wann ihr eure selbstgesteckten Ziele anpackt. Fangt damit an, weniger Dreck ins Meer zu werfen. Fragt bei Wattwanderungen nach, wie es mir geht. Setzt euch für Schutzgebiete ein. Düngt weniger, fischt weniger. Fragt eure Küstenplanerïnnen, ob sie Sand verstehen – oder nur Beton. Gebt mir etwas Schlick, Zeit und euer Ohr, und ich kümmere mich um den Rest. So schwer ist es gar nicht.
Ihr kennt mich jetzt ein bisschen besser: euren stillen Helden im Schlick. Ich halte das Ökosystem am Leben. Wenn ihr mir helft, helft Ihr Millionen anderen. Eure Kinder staunen schon jetzt oft genug über mich. Sie haben keine Berührungsängste und sehen, was Ihr verlernt oder vergessen habt: Das Leben im Schlick ist mindestens genauso wertvoll wie an Land.
Das Projekt „Ist der Pegel überschritten? Bedeutung, Situation und Zukunft des Weltnaturerbes Wattenmeer“ wurde gefördert von der HERING-Stiftung Natur und Mensch.”