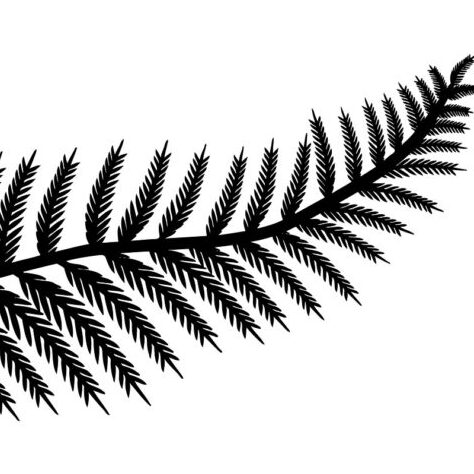Wir stecken mitten im sechsten Massenaussterben. Auch das idyllische Grütried im Thurgau ist davon nicht verschont. Eine Wängemerin hat dort herausgefunden: Zu viel Gülle schadet Flora und Fauna. Die Vielfalt gibt Amélie Quenzer aber noch lange nicht verloren.
Aus den Tümpeln quakt es. Dicke Regentropfen zerplatzen auf unseren Mänteln und auf dem Blätterdach. Alles grünt und wächst. Das Grütried, so scheint es, ist noch weit weg von der Totenstille, vor der die Ökologin Rachel Carson 1962 in «Stummer Frühling» warnte. Und das, obwohl das Ried umgeben ist von konventionell betriebenen Ackerflächen.

Das Grütried schluckt das Wasser, das über drei landwirtschaftliche Drainagen ins Amphibienschutzgebiet dringt. Der nährstoffhaltige Strom durchfliesst das Gebiet und gelangt über den Grütriedbach ins Lauchetal. Für ihre Wettbewerbsarbeit bei Schweizer Jugend forscht wollte die Maturandin Amélie Quenzer aus Wängi herausfinden, wie sich die vielen Nährstoffe auf das Ökosystem auswirken.
Quenzer spielt aus einer breiten ökologischen Partitur
Was recht simpel klingt, sollte Quenzer einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Ihren ursprünglichen Plan, nur Wasserproben für chemische Analysen zu entnehmen, verwarf sie bald, weil die allein «zu wenig aussagekräftig» geworden wären. Sie machte sich an einen ambitionierten Vierschritt:
- Wasserproben entnehmen
- Pflanzen katalogisieren
- Wirbellose Kleinlebewesen analysieren
- Wasseranalysen auf Kieselalgen-DNA vornehmen
Dergestalt konnte Quenzer sehen, wie sich die Vegetation im Grütried von vorne nach hinten, von Wasserzu- bis -abfluss, verändert. Sie verglich sechs Weiher, die am Wasserstrom liegen.
Dazu unterteilte sie das Ried in verschiedene Areale, nahm jeweils den Pflanzenbestand auf und färbte sie von dunkelblau – 0 bis 4 Tier- und Pflanzenarten – bis dunkelgrün ein. Dort wimmelte es mit 35 bis 41 Gattungen vor diversem Leben. Insgesamt bestimmte Quenzer so in mühsamer Feldarbeit 140 Pflanzenarten, ausgenommen alle Büsche und Bäume.
Güllewasser schlägt zerstörerische Breschen
Sie zeigt auf ein Betonrohr, aus dem eine trübe Schlacke ins Ried fliesst:
«Hier, möglichst nah am Rohr, habe ich einige Proben entnommen. Hier riecht man die Gülle richtig.»

Von ihrem Chemielehrer der Kanti Frauenfeld, der Biologielehrerin Daniela Caldelari des Gymnase d’Yverdon und dem Hydrologen Pierre Grob vom Thurgauer Amt für Umwelt lernte sie, Wasserproben zu entnehmen und zu analysieren.
Die Wasserproben untersuchte Quenzer zusammen mit der Universität Lausanne. Die entnahm und sequenzierte die DNA von Kieselalgen und jagte sie durch ihre Datenbank. Die Ergebnisse erlaubten Rückschlüsse auf Artenvielfalt und Qualität des Wassers.
Die Forscherin sah sich bestätigt: Im dunkelblauen Teil der Karte fliesst das nährstoffhaltige Wasser. Dort wuchert das Schilf, das anderem Leben kaum einen Millimeter Platz zugesteht. Das Schilf gedeiht in nährstoffreichen Böden in nassen Gebieten, vor allem wenn es wärmer wird. Es verdrängt Seggen und Orchideen und lässt sich kaum zähmen.
Pflanzen und Tiere zeigen den Nährstoffgehalt an
Schilf ist eine Art «Zeigerpflanze». Es markiert die Orte mit starkem Nährstoffeintrag. «Algen, Sumpfschwertlilien und Sumpfdotterblumen florieren ebenso in nährstoffreichen Böden», erklärt Quenzer. Das Wollgras hingegen zeigt nährstoffarme Böden. Sie lernte, all das zu lesen, und ergänzt:
«Tannenbäume, Heidelbeeren, Efeu und Moos zeigen sauren Boden an.»
Gleiches gilt für Tiere: Köcherfliegen- und Libellenlarven kennzeichnen eine gute Wasserqualität und stabile Werte. Im Gegenteil tolerieren «Egel, Schlickwürmer und Asseln einen schwankenden pH-Wert und brauchen wenig Sauerstoff zum Überleben», sagt Quenzer.
Was das Grütried so schützenswert macht

Quenzer weiss, welch wertvolle Inseln sich im Feuchtgebiet befinden:
«Das Grütried ist wie ein Kissen aus Pflanzen, das auf dem Grundwasser schwimmt: Manche Bereiche sind abgeschirmt vom nährstoffreichen Wasser.»
Seit Beginn ihrer Forschung im Mai 2023 beobachtet Quenzer, dass auf einer dieser Inseln wieder Wintergrün wächst. Um diese selten gewordenen Pflanzen zu schützen, müsse die Fläche offengehalten werden. Sie zeigt auf einen Aronstab, der zwar «giftig, aber ökologisch wertvoll» sei.

Im Grütried leiden vor allem die niedrig wachsenden Pflanzen unter den neuen Lebensbedingungen. Quenzer sagt:
«Das gefleckte Knabenkraut, die Morgensternsegge und das Wollgras – sie wurden alle zurückgedrängt.»
Vor gut 40 Jahren übersäten Mehlprimeln das Ried. Heute sucht man sie vergebens: «Da die Nährstoffe im Boden bleiben, ist dieser Wandel irreversibel», moniert die Forscherin.
Ein «kleiner Flecken Erde», auf dem man den grossen Wandel sieht

Aber nicht nur für Pflanzen verengen sich Lebensräume. Während sich Wasserfrösche als robust erweisen, gebe es nur noch einen von neun Weihern insgesamt, an dem der Kammmolch residiert. Quenzer fürchtet, ihn könnte das gleiche Schicksal ereilen wie den Fadenmolch: «Der ist ganz verschwunden, weil die Nährstoffwerte und Schwankungen zu hoch waren.» Und: Weil vermutlich jemand Goldfische in einem Weiher aussetzte, fressen diese die Kaulquappen einiger Frösche.
Steigen die Temperaturen und sinkt der Wasserstand der Tümpel und Weiher, erreichen diese kritische Werte. Quenzer warnt:
«Da verfehlt das Schutzgebiet seinen Zweck. Gelangen dann noch zusätzlich Nährstoffe in das Grütried, kippen einige Weiher.»
Auch bei Amphibien werde es dann heikel, weil sie durch die Haut atmeten. Quenzer konnte im Grütried ganz schlechte bis gute Wasserqualität messen.
Wie man ins Handeln kommt
Ihre Forschung zeigt: Ohne gezielte Massnahmen könnte das Grütried seine wertvolle Biodiversität unwiderruflich verlieren. «Im Grütried und überall auf der Welt wirkt sich Gülle stark auf die Umwelt aus.» Das Ried wirke als Nährstofffilter, sodass der Abfluss weniger stark von Pestiziden und Gülle belastet sei als der Zufluss. Sie konstatiert:
«Man sollte Gülle mehr thematisieren.»
Aktuell werde das nährstoffreiche Wasser von den Feldern «nicht durchdacht» ab- oder umgeleitet. Um die Artenvielfalt zu erhalten, müssten Umweltschützer und Landwirtinnen zusammenarbeiten und Drainagen während der Gülleausbringung schliessen. Sie alle müssten mit ins Boot geholt werden, «um wieder mehr in eine Balance mit der Natur zu finden». Sie fordert, dass sich Umweltschützer, Hydrologinnen und Landwirte eng absprechen und sich für den Umweltschutz zusammenschliessen.
Jury der Schweizer-Jugend-forscht-Organisation honoriert ihre Forschung
All ihre Erkenntnisse mündeten sowohl in ihrer Maturaarbeit als auch in der Wettbewerbsarbeit bei Schweizer Jugend forscht. Die Jurys im Vorentscheid in Lausanne und im Finale in Fribourg waren begeistert und verliehen ihr das beste Prädikat, «hervorragend». Quenzer darf nun mit Sail & Explore die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Umwelt, die menschliche Gesundheit und den Meeresschutz auf einem Segelschiff auf den Azoren erforschen.
Nach ihrer Matura an der Kantonsschule Frauenfeld wird Quenzer der Forschung treu bleiben. Sie sagt: «Ich will draussen sein. Etwas zu Geologie oder Umwelt machen.»