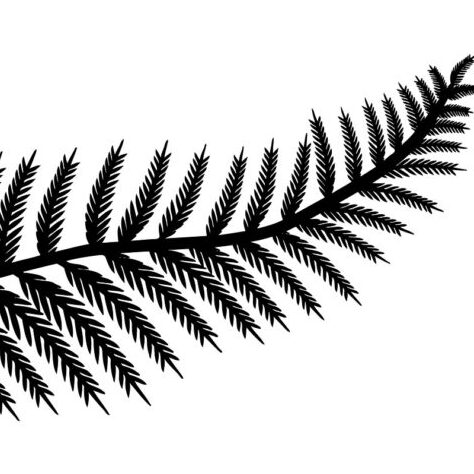Wenn Martin Kögler durch den Dachstuhl des Tröckneturms streift, klingt es nach Abschied – aber nicht nach Resignation. Der Ornithologe hat tausende Vögel schlüpfen, fliegen und wiederkehren sehen. Er selbst ist geblieben: als Wächter einer wilden Stadtnatur. Und als Mahner, sie nicht zu vergessen.

«Ich bin 86 und stehe noch immer gerade», sagt Martin Kögler, während er die Treppe im Tröckneturm erklimmt. Es riecht nach altem Holz, jeder Schritt knarzt. Im Dachstuhl angekommen, zeigt Kögler auf all die Nistkästen für Mauersegler und ihre grösseren, robusteren Genossen, die Alpensegler. Sonnenlicht bricht durch die Einflugschneisen im Dach, ähnlich wie durch eine Baumkrone.
1990 montierte Kögler die ersten vier Kästen, heute hängen mehr als hundert im Gebälk. Ihn trieb eine «Allergie» an, wie er sagt: «Mich störte, den Tröckneturm so ungenutzt zu sehen, während die Mauersegler keine Heimat mehr haben.» 35 Jahre später erntet er die Früchte seiner Arbeit. Bald werden bis zu 400 Vögel den Turm umschwirren und sich ein Fettpolster für den Flug über die Sahara anfressen.

Ein Berliner Bub wächst mit Vogelgesang auf
Kögler war neun, als er sah, wie ein Kuckuck sein Ei in ein fremdes Nest legte. Das Junge schlüpfte, kegelte alle anderen Eier raus – und wurde später selbst von einer Krähe gefressen. Der Vogel liess ihn nie mehr los, weiss der Kuckuck warum.
In seinem Geburtsort Berlin blühte seine Vogelliebe früh auf: Sein Onkel leitete die Biologische Reichsanstalt und nahm den zwölfjährigen Neffen mit raus, zwischen Spree und Havel. Kögler schleppte für ihn die Kamera und das Tonbandgerät, mit dem sein Onkel Vogelstimmen aufzeichnete. «Das hat mich tief beeindruckt», sagt er.
Der Vater? Weg. «Vier Kinder gemacht, dann abgehauen.» Doch Kögler erinnert keine Nachkriegsnöte. Nur das Staunen über die Vogelleidenschaft seines Onkels, von der er sich packen und mittragen liess.
1963 verschlug es Kögler in die Ostschweiz – das Jahr, als der Bodensee letztmals komplett zufror. Damals glaubte er, der Obersee würde dies jedes Jahr aufs Neue tun, und lehnte das Angebot eines Freundes ab, zum deutschen Ufer zu laufen.
Im Turm verbirgt sich sein Vermächtnis
Zurück im Tröckneturm humpelt er über Dielen, murrt über verschobene Bretter: «Da stürzt noch einer in den Tod!» Die Folgen eines Autounfalls verleiden ihm das Gehen. Führungen gibt er keine mehr. Kögler schleppt ein paar Holzplatten und öffnet prüfend einen Nistkasten. Ende April erwartet er die ersten Mauersegler.
Wie der Vogelschutz insgesamt ist der Tröckneturm ein Fass ohne Boden und erfordert ständige Fürsorge. Einen Schönheitspreis gewinnt der denkmalgeschützte Turm nicht mehr, jedenfalls von innen. «Die Bretter und Dielen habe ich vor dreissig Jahren allein hochgetragen, das war eine stramme Leistung von mir», sagt Kögler. Damals sei er ein «gelenkiges Stehaufmännchen» gewesen. Aber der Turm nützt, sagt Kögler: Hier findet die grösste Mauerseglerkolonie der Ostschweiz Unterschlupf.

Die ersten drei Jahre zogen keine Vögel ein, sie zierten sich. Dann stellte der Büezer ein Tonbandgerät auf den Dachboden und spielte Seglerrufe ab. «Ruckzuck zogen über Nacht Mauersegler in sechs Kästen», sagt Kögler. Im Jahr darauf belegten sie doppelt so viele.
Am Anfang kämpfte Kögler allein auf weiter Flur, «zahlte alles aus dem eigenen Sack» und päppelte Mauersegler zu Hause auf. In den letzten zwanzig Jahren hätten das Amt für Umwelt und «Stadtgrün» ein neues Bewusstsein entwickelt, Flächen unversiegelt zu halten. Sein Leben lang wehrt sich der Vogelschützer gegen zubetonierte Böden, holzverkleidete Wände und abgedichtete Scheiben.
Heute bezahle der Naturschutzverein St.Gallen Köglers Rechnungen und montiere eigenständig Vogelkästen. Knapp vier Jahrzehnte stand der 86-Jährige dem Verein vor und leitete den Fachbereich Ornithologie. Mit seinem Rücktritt dieses Jahr endet eine Ära. Sein Nachfolger Daniel Lieberherr spricht von einem «unermesslichen Beitrag», den Kögler für eine blühende Stadtnatur leistete.
In den Wäldern verstummen die Vögel
Die Ostschweizer Vogelwelt habe sich in den letzten sechzig Jahren stark verändert, sagt Kögler: «Früher ging ich davon aus, Vögel wären unverwüstlich. Heute weiss ich: Das sind sie nicht.» Trat er als junger Mann zwischen Bäume, «jubelte der Wald»: «Es war ein wahres Konzert, mit Vögeln, die um 4 Uhr morgens, andere um 5 Uhr oder 6 Uhr, in den Chor einstimmten.» Wo heute zwei Drosseln, eine Amsel, drei Rotkehlchen und ein Zilpzalp zwitschern, seien früher Hunderte Stimmen erklungen.

Den Spechten gehe es zwar gut, aber Haubenmeisen oder Kleiber sehe er immer weniger in den St.Galler Wäldern. Wenn nicht einmal die geläufigen Blau- oder Kohlmeisen in die Nistkästen ziehen, bleiben sie oft leer. Und zu viele Kästen auf engem Raum schaden, denn die Meisen fressen seltene Nachtfalter wie den Nagelfleck.
Auch «sein» Kuckuck hungert und findet immer weniger der haarigen Raupen, die er liebt. Kögler beobachtet ein dramatisches Insektensterben. Werden Felder im Thurgau intensiv bewirtschaftet, Insektizide versprüht und der Wald aufgeräumt, geht dem Vogel das Futter aus. Der Kuckuck kommt immer zur gleichen Jahreszeit im Mai. Andere Vogelarten passen sich an die Klimakrise an, sind früher in St.Gallen und fressen ihm die Insekten weg.

«Ich würde dem Kuckuck sagen: Kehr um und flieg zurück, wo du hergekommen bist», sagt Kögler. In den letzten Jahren flieht der Vogel in die seltenen Auwälder, nach Glatt oder in die Thurauen.
Zurückziehen? Kommt für ihn nicht infrage
Kögler denkt nicht daran, aufzustecken. Sein Glaube an die Macht der kleinen Schritte lebt weiter. Und oft verlor sich die Spur einer Vogelart, bis diese plötzlich und in grosser Zahl wieder in den Stadtwäldern auftauchte. Dafür schafft er den nötigen Lebensraum.
Der St.Galler Naturschutzverein kooperiert mit Förstern und wirbt dafür, Totholz liegen zu lassen. Das Ast- und Zweiggewirr ersetzt Nistkästen und bietet Insekten wie Vögeln Schutz und Nahrung.

Auch lasse sich die Generation Z für den Vogelschutz gewinnen. «Du musst ihnen die Begeisterung bringen», sagt Kögler. Noch weiteten sich alle Augen, sehen Kinder einer Buntspechtmutter beim Füttern zu. Oder wenn er früher auf einen Baum kletterte und behutsam einen Korb mit Waldkauzjungen herunterliess: «Da war ich der König», sagt Kögler.
Ein letztes Mal leuchtet der Vogelschützer mit der Taschenlampe über die Nistkästen im Tröckneturm, bevor er die Holztreppen hinunterhumpelt. Vielleicht hört er in ein paar Tagen den ersten Kuckuck singen. Und vielleicht folgt er diesem Ruf in den St.Galler Wald.