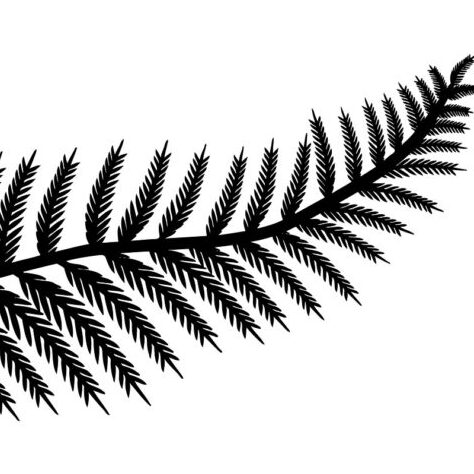Die Klimakrise kommt schneller, als Bäume wachsen. Höhere Temperaturen, längere Trockenzeiten, neue Baumkrankheiten: Regionalförster Raphael Lüchinger spürt den Wandel täglich. Lösungen? Gibt es – aber sie brauchen Mut, Zeit und Geld.

Raphael Lüchinger liebt es, den Schreibtisch gegen den Wald einzutauschen. Der Gründenwald ist seine Waldregion – und seine Herausforderung.
Lüchinger und seine 13 Försterinnen und Förster müssen die im Schweizer Waldgesetz festgelegten Waldfunktionen schützen: Trotz Klimakrise soll der Wald Holz abwerfen. Zudem muss der Wald Lebensraum für diverse Pflanzen- und Tierarten bieten. Und der Mensch soll sich auch in Zukunft im Wald erholen können.
Der Förster stösst den langsamen Wandel an
«Wir spüren die erhöhten Temperaturen», sagt er. Der Klimawandel finde statt und fordere sein Team heraus, den Wald aktiv an die Krise anzupassen.
Mehr Trockenheit, frühere Blüte, sturmempfindliche Nadelhölzer. Die Eschen sterben, Borkenkäfer vermehren sich.
Ohnmacht ob der vielen Aufgaben kennt Lüchinger nicht: «Mit dem Klimawandel nehmen die Probleme zu. Aber dafür sind wir Förster ausgebildet. Wir finden Lösungen.»
«Einige Leute bambifizieren den Wald»
Unter Bäumen prallen Waldbilder aufeinander. «Die Entfremdung ist ein Problem», sagt Lüchinger. «Auf der anderen Seite wird der Wald romantisch betrachtet, wie im Film Bambi.» Der stadtnähere Gründenwald ist besonders umkämpft. Lüchinger sagt: «Jedes Mal, wenn wir Bäume fällen, müssen wir das begründen.» Steht ein Holzschlag an, kündige das seine Behörde öffentlich an und führe einige Telefonate.
«Trotzdem haben viele Menschen eine grundsätzlich positive Sicht auf den Wald – darüber bin ich sehr froh», sagt Lüchinger.

Gerade ältere Menschen aus der Nachkriegsgeneration, die nach Feuerholz im Wald suchten, stiessen sich daran, wie «unordentlich» es an manchen Orten aussieht. «Für Käfer, Specht und Pilz ist das Totholz hier aber ökologisch wertvoll», sagt Lüchinger. «Wild» sei der Wald aber noch lange nicht. Für ihn steht fest: Der Schweizer Wald ist seit Jahrhunderten eine Kulturlandschaft, vom Menschen geformt.
Lüchinger denkt in diesem Massstab, bis aus einem Keimling ein Baum wird: 100 Jahre. Und er muss ausprobieren, welche Waldbausysteme passen könnten. Im Plural. Denn Einheitslösungen wie der Ruf nach dem sich selbst erhaltenden «Dauerwald» oder die Thesen des deutschen Försters Peter Wohlleben werden «strapaziert», sagt Lüchinger.
Lüchinger will aus Stürmen lernen
Querwaldein stapft er los und zeigt auf Schneisen, die der Sturm Lothar vor 25 Jahren riss. Vor allem Fichten knickten um – wirtschaftlich interessant, aber flach wurzelnd.
Nach dem Sturm wagte der damalige Förster ein Experiment und reagierte so, wie Lüchinger heute der Klimakrise begegnet: Er begann, einen Laubmischwald anzulegen. «Diesen Windgeschwindigkeiten hätte aber auch der nicht standgehalten», sagt Lüchinger. Er nahm kurz nach Lothar seinen Beruf beim Kanton St.Gallen auf.

Nun setzt der Regionalförster unter anderem auf Eichen. Die häufen im Winter jedoch Nassschnee auf ihrer Krone an, sodass sie reihenweise umknicken. Wie andere klimafitte Bäume leiden Eichen auch unter dem Wild, das die jungen Triebe abfrisst. Damit in der nächsten Baumgeneration alle paar Meter eine Eiche zu finden ist, umzäunt Lüchingers Team die gepflanzten Bäume, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass mehr Licht in den Wald kommt, damit die Wildtiere mehr Nahrung finden.

Der Holzpreis will nicht steigen
Lüchinger beobachtet, wie das Vertrauen in Fachleute wie ihn erodiert. Dazu trage auch das Internet bei: «Manche Leute googeln zweimal und denken, sie wären Förster.» Zücken die Forstwarte die Motorsäge, löse das negative Gefühle bei einigen aus.
«Aber der Schweizer Wald überaltert. Wir nutzen weniger Holz als das, was nachwächst.» 25 Franken kostet der Schutz eines Jungbaums – hochgerechnet auf die Waldfläche und ein Baumalter ist das mehr, als der Holzverkauf einbringt. Lüchinger: «Der Wald rentiert kaum mehr.» Zentral seien daher die Gelder von Kanton und Bund für die Aufforstung.

Aufgeben ist keine Option. Holz ist der einzige einheimische Rohstoff, der nachwächst. Die Wirtschaftlichkeit ist wichtig, müssen doch die Waldeigentümer Waldpflege, Neuaufforstung, Strassen und Förster bezahlen. Und: «Je mehr Menschen mit Holz bauen, desto höher der Holzpreis. Deswegen ist die Holzförderung ein zentrales Anliegen.»
Er steuert das Licht und vertraut auf die Natur
Hinter einer Lichtung bleibt der Regionalförster stehen und schiebt mit seinem Fuss Blätter beiseite: «Hier haben wir ein grösseres Problem mit dem Brombeer-Teppich – darunter können keine Pflanzen mehr keimen.» Bleibt das Blätterdach geschlossen, müssen er und die Forstwarte vier bis fünf Jahre junge Pflanzen ausmähen, damit sie eine Chance haben.
Nicht alles aus Lüchingers Instrumentenkasten funktioniert. Als Förster weiss er, wie anpassungsfähig Traubeneichen, Linden, Vogelkirschen und Waldföhren sind. Aber nur weil sich zum Beispiel eine Buchenart in Italien als trockenheitstolerant bewiesen habe, müsse dasselbe nicht für den St.Galler Wald gelten. Grundsätzlich gilt: Je diverser der Baummix, desto krisenfester ist der Wald.
Gerade weil er aber nicht alles steuern könne, sei er gelassen und vertraue der Kraft der Natur: «Der Wald wächst weiter, mit oder ohne uns.» Die Frage ist nur, ob der Wald die Ansprüche erfüllen kann, die wir Menschen an ihn stellen.